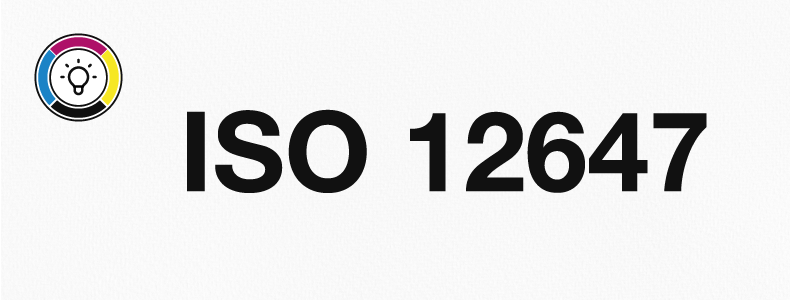Fragst du dich, was es mit der ISO-12647-2 auf sich hat? Diese internationale Norm ist das Fundament für standardisierten Qualitätsdruck und spielt eine zentrale Rolle im Color Management (Farbmanagement) der Druckindustrie. In diesem Artikel erfährst du den aktuellen Stand der ISO-12647-2, was sich bei der letzten Überarbeitung geändert hat und wie du die Norm in der Praxis anwendest.
Ich beleuchte die Praxisanwendung in Druckereien, erklären den Zusammenhang von Farbmanagement und Farbprofilen, gehe auf Papiertypen und Farbwerte ein, vergleichen die Norm mit früheren Versionen und gebe dir hilfreiche Tipps für die Umsetzung. Los geht’s!
Aktueller Stand der ISO-12647-2 – Überblick und Neuerungen
Die ISO 12647-2 ist ein Teil der Normenreihe ISO 12647 und definiert Prozesskontrollen für den Offsetdruck. Sie legt zahlreiche Prozessparameter fest – unter anderem Sollwerte für Farben und Tonwertzunahmen (Dotgain) – um in der Druckproduktion reproduzierbare Ergebnisse sicherzustellen . Seit 2013 gilt die dritte und aktuelle Ausgabe der ISO 12647-2 (ISO 12647-2:2013), welche die vorherige Version von 2004/2007 umfassend überarbeitet hat .
Was ist neu in der ISO-12647-2:2013?
Die Revision brachte einige wichtige Änderungen und Aktualisierungen mit sich :
- Keine Filme mehr: Alle veralteten Anforderungen für filmbasierte Prozesse wurden gestrichen – die Norm fokussiert jetzt vollständig auf den digitalen Workflow.
- Überarbeitete Andruck- und Proof-Vorgaben: Die Anforderungen an Proofs (ISO 12647-7) wurden angepasst. Insbesondere werden neue Kontrollstreifen (z.B. der ECI/bvdm Gray Control Strip) und genauere Toleranzen verwendet. Die Farbabweichungen zwischen Proof und Druck werden nun häufig mit DeltaE2000 bewertet, einem moderneren Maß, das Unterschiede näher an der menschlichen Wahrnehmung beurteilt (vorher war meist DeltaE76 üblich).
- Aktualisierte Druckbedingungen: Es gab Änderungen bei den definierten Druckbedingungen (Printing Conditions). Neue Referenz-Druckbedingungen wurden eingeführt, etwa FOGRA51 und FOGRA52 für verschiedene Papiertypen (dazu gleich mehr), während ältere Bedingungen ersetzt oder ergänzt wurden. Diese neuen Bedingungen setzen aktualisierte Zielwerte für Farben und Tonkurven fest, um besser zur heutigen Papier- und Farbchemie zu passen.
- Geänderte Farbwerte der Volltöne: Die erlaubten CIELAB-Farbwerte für die Primärfarben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz (Volltonflächen) sowie Sekundärfarben (Rot, Grün, Blau aus Überdruck) wurden „der Realität angepasst“. Das heißt, die Norm trägt nun den heutigen Druckfarben und Papieren Rechnung – z.B. moderne Papiere mit optischen Aufhellern haben einen anderen Weißton, und das spiegelt sich in den Sollwerten wider.
- Neue Tonwertzunahme-Kurven: Die Dotgain- oder Tonwertzunahmekurven wurden neu definiert. Wichtig dabei: In der aktuellen Norm sind die Tonwertzunahmen für alle Prozessfarben einheitlich gestaltet. Früher hatten z.B. Cyan/Magenta/Gelb vs. Schwarz teils unterschiedliche Kurven; jetzt folgen C, M, Y und K derselben Zielkurve, was die Kalibrierung erleichtert. Zudem wurde auch der Fall von Frequenzmodulationsraster (FM-Raster) in der Norm abgedeckt.
- Messbedingungen modernisiert: Eine der bedeutendsten Neuerungen ist die Berücksichtigung der Messbedingung M1 (gemäß ISO 13655). M1 entspricht Messung mit einer Beleuchtung, die D50-Tageslicht inklusive UV-Anteil simuliert. Damit werden optische Aufheller im Papier beim Messen einbezogen. Im Klartext: Ein Druck auf aufgehelltem Papier wird unter M1 anders gemessen als unter der alten M0-Bedingung, was zu realistischeren Lab-Werten führt. Für die Praxis heißt das, dass Proofs und trockene Andrucke idealerweise mit M1-fähigen Geräten gemessen werden sollten, damit Proof und Auflagendruck farblich übereinstimmen. (Im Produktionsdruck selbst kann zur Prozesskontrolle weiterhin M0/M2 genutzt werden, aber für den Abgleich von Proof zu Druck ist M1 entscheidend.)
- Allgemeine Aktualisierung und Bereinigung: Die Norm wurde insgesamt klarer strukturiert und an aktuelle Gegebenheiten angepasst. Viele Details wurden präzisiert, um Missverständnisse zu vermeiden – etwa klare Definitionen der Papiertypen, Referenzdruckbedingungen und Toleranzen.
Durch diese Änderungen ist ISO 12647-2:2013 der aktuelle Standard für den Offsetdruck, der weltweit in der Branche als Referenz dient. In Deutschland ist die Norm auch als Teil des ProzessStandard Offsetdruck (PSO) verankert, dem Leitfaden für standardisierte Druckproduktion. Die Einführung der neuen Norm erfolgte mit einer Übergangszeit: Ab 2015/2016 haben Verbände wie bvdm, Fogra und ECI die neuen Charakterisierungsdaten (FOGRA51/52) und ICC-Profile veröffentlicht und empfohlen. Inzwischen setzen immer mehr Druckereien und Dienstleister auf diese aktuellen Standards, um Qualität und Farbverbindlichkeit sicherzustellen.
ISO 12647-2 in der Praxis – Anwendung, Vorteile und Herausforderungen
Wie wird ISO 12647-2 nun im Alltag der Druckbranche eingesetzt? In der Praxis bildet die Norm die Grundlage, um den gesamten Druckprozess von der Vorstufe bis zur Druckmaschine zu kontrollieren und abzustimmen. Hier ein Überblick, wie Agenturen, Druckereien und Verlage davon profitieren und womit sie sich auseinandersetzen müssen:
Einheitliche Sprache zwischen Auftraggeber und Drucker
Die Norm liefert klare Zielwerte. Wenn du als Agentur ein PDF/X-Druck-PDF erstellst und als Ausgabefarbraum z.B. „ISO Coated v2“ oder „PSO Coated v3“ angibst, wissen alle Beteiligten, woran sie sind. Der Drucker versteht genau, welches Farbprofil und welche Bedingungen du voraussetzt. Dieses gemeinsame Referenzsystem reduziert Missverständnisse. Es ist einfacher, Kunden zu erklären, was machbar ist, und Reklamationen vorzubeugen, da alle vom selben „Standard-Druck“ sprechen.
Qualitätssicherung in der Druckerei
Für Druckereien ist ISO 12647-2 ein zentrales Werkzeug des Qualitätsmanagements. Maschinen werden nach der Norm eingerichtet und kalibriert, um die vorgegebenen Soll-Farbwerte und Tonwertkurven zu treffen. Viele Druckereien lassen sich nach PSO (ProzessStandard Offset) zertifizieren, was bedeutet, dass ein neutraler Prüfer (z.B. Fogra oder bvdm) bestätigt, dass nach ISO 12647-2 gedruckt wird. Für dich als Mitarbeiter einer Druckerei bedeutet das: regelmäßige Kalibrierung der Maschinen, Kontrolle mit Prüfdruck-Streifen (z.B. Medienkeil) und Messung der Druckbögen. Die Norm gibt Toleranzen vor – liegt der Druck innerhalb dieser, kann man dem Kunden eine normgerechte Qualität zusichern.
Vorteile: Konstante und reproduzierbare Farben
Der größte Vorteil der Norm in der Praxis ist die Konstanz. Wenn du heute einen Job druckst und in einem Jahr nach denselben ISO-12647-2-Einstellungen wiederholst, sollten die Ergebnisse nahezu identisch aussehen – selbst auf unterschiedlichen Maschinen oder in unterschiedlichen Betrieben. Diese Reproduzierbarkeit spart Zeit und Geld, da weniger Korrekturdurchläufe und Proofs nötig sind. Außerdem erleichtert es Proofing: Ein digitaler Proof, der nach ISO 12647-7 erstellt und validiert wurde, dient als verlässliche Vorschau. Druckerei und Kunde können sich darauf verlassen, dass der Auflagendruck dem Proof sehr nahe kommt.
Herausforderungen: Investition und Schulung
Die Umsetzung der Norm ist nicht trivial. Es erfordert Know-how im Farbmanagement und mit Messgeräten. Mitarbeiter müssen geschult werden, Lab-Messwerte und DeltaE zu verstehen. Zudem erfordert die Umstellung auf neue Versionen der Norm Investitionen: Beispielsweise mussten viele Betriebe für ISO 12647-2:2013 ihre Messtechnik upgraden (Anschaffung von M1-Spektralfotometern) und neue Proof-Papiere kaufen, die optische Aufheller enthalten. Auch Software (RIP-Systeme, Farbmanagement-Tools) mussten aktualisiert werden, um die neuen Profile und DeltaE2000-Bewertungen zu unterstützen . Nicht zuletzt muss der gesamte Workflow – von der Datei (mit eingebettetem ICC-Profil) bis zum Druck – aufeinander abgestimmt sein. Das erfordert anfänglich Aufwand und Sorgfalt.
Zusammenarbeit in der Lieferkette
Eine weitere praktische Herausforderung ist die Abstimmung zwischen Vorstufe und Druck. Agenturen und Designer müssen die richtigen Farbprofile verwenden und ihre Daten korrekt anlegen. Druckereien müssen diese Profile in der Weiterverarbeitung berücksichtigen. Wenn z.B. eine Agentur noch mit dem alten ISOcoated_v2-Profil arbeitet, die Druckerei aber nach PSO Coated v3 druckt, können leichte Farbabweichungen auftreten. Deshalb ist Kommunikation wichtig: Viele Druckereien geben ihren Kunden Druckdaten-Tipps, welche Profile sie erwarten (etwa via Datenblätter oder auf ihrer Website).
Zusammengefasst bietet die Norm einen gemeinsamen Rahmen, innerhalb dessen alle arbeiten. Hast du die ISO 12647-2 im Griff, hast du einen echten Wettbewerbsvorteil: Du kannst Konsistenz garantieren, genießt Vertrauen bei Kunden und reduzierst Kosten durch weniger Proof-Schleifen und Reklamationen. Es erfordert zwar Disziplin und Verständnis, aber die Mühe lohnt sich durch effizientere Abläufe und bessere Ergebnisse.
Farbmanagement und Farbprofile nach ISO 12647-2
Farbmanagement (Color Management) und ISO-12647-2 gehören untrennbar zusammen. Die Norm definiert die Ziele – das Farbmanagement liefert die Werkzeuge, um diese zu erreichen. Doch wie spielen Farbprofile, Messbedingungen und Standardisierung genau zusammen?
ICC-Farbprofile als Brücke
Die in der Norm definierten Farbwerte werden in ICC-Profile gegossen, damit Software und Geräte damit arbeiten können. In Europa erstellt die ECI (European Color Initiative) solche Profile auf Basis der Fogra-Daten. Beispiele: ISOcoated_v2 (Fogra39) für gestrichenes Papier nach der alten Norm und PSO Coated v3 (Fogra51) für Premium-Bilderdruckpapier nach der neuen Norm . Diese Profile beschreiben den Farbraum der jeweiligen Druckbedingung. Wenn du also ein Dokument mit dem Profil „PSO Coated v3“ erstellst, weiß das Color-Management-System genau, wie Cyan etc. im Druck aussehen sollen. Im Proof wird dieses Profil genutzt, um dir am Bildschirm oder auf dem Proofdrucker die späteren Druckfarben korrekt zu simulieren.
Messbedingungen und Beleuchtung
ISO 12647-2 gibt genau vor, wie gemessen werden muss, damit alle auf der gleichen Basis arbeiten. Gemäß ISO 13655 erfolgt die Messung bei Normlicht D50 (entspricht Tageslicht 5000K), 2°-Beobachterwinkel und 45/0° Geometrie . In der neuen Edition kommt wie erwähnt die Messbedingung M1 ins Spiel, die den UV-Anteil berücksichtigt. Warum ist das wichtig? Viele moderne Papiere – vor allem hochweiße – enthalten optische Aufheller. Diese leuchten unter UV-Licht blau und machen das Papier heller/bläulicher. Wenn nun der Proof auf Papier ohne Aufheller gedruckt wird und mit einem Gerät gemessen wird, das UV herausfiltert (M0), kann es passieren, dass Proof und Produktion unterschiedlich bewertet werden. Standardisierung im Druckprozess heißt hier: Alle verwenden möglichst dieselbe Beleuchtung und Messtechnik. Darum: Beleuchtungsnorm ISO 3664:2009 verlangt D50-Normlicht in Betrachtungsräumen, und ISO 12647-2 verlangt konsistente Messbedingungen . So stellst du sicher, dass ein Lab-Wert bei dir dasselbe bedeutet wie in der Druckerei nebenan.
Farbprofile richtig einsetzen
Für dich im Alltag heißt das: Nutze die richtigen Profile und Bedingungen in jeder Produktionsstufe. In der Bildbearbeitung und im Layout solltest du den Arbeitsfarbraum und das Ausgabeprofil passend wählen (z.B. ISO 12647-2 konformes Profil wie PSO Coated v3 für Bilderdruckpapier). Beim Erstellen des PDFs musst du das Ausgabe-Intent-Profil einbetten oder zumindest benennen. Beim Proofen muss das RIP wissen, auf welche Bedingungen es simulieren soll – und es braucht das passende Proofpapier. Hier greifen wieder die Profile: Ein Proof für ISOcoated_v2 wird auf Proofpapier ohne Aufheller passen, ein Proof für PSOcoated_v3 hingegen sollte auf Papier mit Aufhellern erfolgen , damit der Papierfarbton stimmt. All das wird durch Farbmanagement-Workflows und ICC-Profile ermöglicht.
Standardisierung durch Prozesskontrolle
Farbmanagement ist nicht nur Profile schubsen – es muss auch gemessen und nachgeregelt werden. ISO 12647-2 liefert Ziel-Lab-Werte und Toleranzen. Das heißt z.B., 100% Cyan auf Papier Typ 1 soll ungefähr einen CIELAB-Wert von L~54, a-36, b*-50 erreichen (gemessen mit der definierten Methodik) . In der Druckerei werden Kontrollkeile mit solchen Volltonfeldern mitgedruckt und mit dem Spektralfotometer gemessen. Weichen die Werte zu stark ab, muss nachjustiert werden (etwa die Farbdichte an der Maschine erhöhen oder senken). Ähnliches gilt für Tonwertzunahme: die Rastertonwerte (z.B. 50% Raster) werden gemessen und mit der Sollkurve verglichen. Kurz gesagt: Farbmanagement + ISO-Norm = Prozesskontrolle. Du sorgst dafür, dass Eingabe (Druckdaten mit Profil) und Ausgabe (gedrucktes Ergebnis) übereinstimmen, indem du den Prozess kalibrierst und konstant hältst.
Vernetzung mit anderen Standards
ISO 12647-2 ist Teil eines größeren Ganzen im Druck-Farbmanagement. Weitere Normen wie ISO 12647-7 (Proof) und ISO 12647-8 (Validierungsdruck) ergänzen sie. Außerdem greifen Konzepte wie Graubalance (Neutralität in den Grautönen) – dazu gibt es z.B. den erwähnten Gray-Control-Streifen von ECI/bvdm . Auch G7 (in den USA verbreitet) ist ein Ansatz zur Prozesskalibrierung, der ähnliche Ziele verfolgt. In Europa hat sich aber PSO nach ISO 12647-2 als de-facto-Standard durchgesetzt. Für dich bedeutet das: Wenn du dich an ISO 12647-2 hältst, erfüllst du im Grunde auch die Anforderungen des deutschen „MedienStandard Druck“ und hast ein System, das international verstanden wird.
Papiertypen und Farbwerte in der ISO 12647-2
Nicht jeder Druck erfolgt auf dem gleichen Papier – ein Hochglanz-Magazin unterscheidet sich stark von einem Roman auf Naturpapier. Die ISO 12647-2 trägt dem Rechnung, indem sie verschiedene Papiertypen definiert und für jeden Typ spezifische Farbwerte festlegt. So wird gewährleistet, dass du je nach Papier immer die richtigen Ziele ansteuerst.
Die fünf Papiertypen nach ISO 12647-2
Die Norm berücksichtigt im Offsetdruck fünf Haupt-Papierklassen (Typ 1 bis 5) :
- Papiertyp 1: Gestrichenes Papier, weiß, holzfrei, ca. 115 g/m², glänzend (hochglänzender Bilderdruck). Dieses Papier hat eine sehr hohe Weiße und einen gewissen Glanz.
- Papiertyp 2: Gestrichenes Papier, weiß, holzfrei, ca. 115 g/m², matt (mattgestrichenes Bilderdruckpapier). Ähnliche Weiße wie Typ 1, aber mit matter Oberfläche (weniger Glanz).
- Papiertyp 3: Leichtgewichtiges, gestrichenes Papier (LWC – Light Weight Coated), z.B. ca. 60-70 g/m², typischerweise für Rollenoffset (Zeitschriften, Kataloge mit dünnem Papier). Etwas geringere Weiße oder Opazität, meist glänzend gestrichen.
- Papiertyp 4: Ungestrichenes Papier, weiß, Offsetqualität, ca. 90–120 g/m² (klassisches holzfreies Naturpapier, z.B. Briefpapier oder Bücher mit weißem Papier). Hohe Weiße, aber ungestrichen (raue Oberfläche, saugfähiger).
- Papiertyp 5: Ungestrichenes Papier, gelblich, Offsetqualität, ca. 90–120 g/m² (Naturpapier mit Cream- oder Chamois-Ton, z.B. Romanpapier oder gelbliches Werkdruckpapier). Dieses Papier hat einen deutlichen Gelbstich und weniger Helligkeit.
Jeder dieser Papiertypen hat von der Norm definierte Referenzwerte, insbesondere den Papierweißton in CIELAB und die Glanz-Eigenschaften . Warum ist das wichtig? Weil die Farbwiedergabe stark vom Papier beeinflusst wird. Ein Cyan auf gestrichenem Papier (Typ 1) leuchtet kräftiger als auf ungestrichenem (Typ 4), wo es matter und dunkler erscheint. Die Norm definiert daher für jeden Typ separate Soll-Farbwerte der Druckfarben.
Definierte Farbwerte (Lab) für Papier und Skalenfarben
Für jeden Papiertyp legt ISO 12647-2 sowohl den Lab-Farbwert des Papierweiß (also unbedrucktes Papier) als auch die Lab-Werte der Volltonfarben Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz (100% Flächen) fest – und zwar unter Standard-Messbedingungen (D50 Licht, bestimmte Unterlage etc.). Beispielsweise ist für ein glänzend gestrichenes Papier (Typ 1) ein Papierweiß von ca. L≈93, a≈0, b≈-2 (auf weißer Unterlage gemessen) vorgegeben . Das heißt, das Papier soll sehr hell und minimal bläulich sein. Ein gelbliches ungestrichenes Papier (Typ 5) dagegen hat etwa L≈88, a≈0, b≈+6 (schwarze Unterlage) – also dunkler und deutlich gelbstichig. Diese Werte dienen als Referenz, um Papiere einzuordnen. In der Praxis darf es kleine Abweichungen geben (Toleranz meist ΔE um die 3–5), aber grundsätzlich sollte das Papier in diesen Farbrahmen passen.
Auch für die Druckfarben sind Lab-Sollwerte angegeben. Für 100% Cyan auf Typ1-Papier liegt der Zielwert beispielsweise im Bereich L* ~54, a* -36, b* -50 (schwarze Unterlage) . Magenta ~ L46, a72, b*-5; Gelb ~ L87, a-6, b~90; Schwarz ~ L16, a0, b0 (jeweils auf Auflagendruck, also meist messbar auf schwarzer Unterlage) . Diese Zahlen musst du nicht auswendig kennen, doch sie sind die Benchmarks. Sie stammen aus den Charakterisierungsdaten (wie FOGRA51/Fogra39 etc.) und definieren den Farbraum. Wichtig ist: Die Norm sagt, wie „bunt“ oder „dunkel“ eine Farbe auf dem jeweiligen Papier sein soll.
Dabei berücksichtigt ISO 12647-2 auch praktische Gegebenheiten: Durch die neue M1-Messung wurden die Papierweiß-Werte realistischer, insbesondere bei Typ1 und 2, die oft optische Aufheller haben (erkennbar am stärker negativen b-Wert) . Früher waren diese Effekte unter UV-ignorierender Messung unterschätzt. Außerdem sind, wie oben erwähnt, die Tonwertzunahmen pro Papiertyp festgelegt. Grob gesagt haben ungestrichene Papiere etwas höhere Tonwertzunahme (weil die Rasterpunkte mehr zulaufen), was in der Norm durch andere Kurven berücksichtigt wird.
Ein Detail: Die Sekundärfarben Rot (M+Y), Grün (C+Y) und Blau (C+M) werden zwar in den Fogra-Daten tabelliert, sind aber nicht normativ vorgeschrieben . Die Norm konzentriert sich auf die Primärfarben und Papier, während die aus zwei Farben gemischten Volltöne eher abgeleitete Werte sind. Sie liegen jedoch erfahrungsgemäß in einem gewissen Bereich und die Fogra-Charakterisierungsdatensätze liefern diese als Anhaltspunkt.
Für dich praktisch bedeuten die definierten Papiertypen und Farbwerte: Wähle das richtige ICC-Profil entsprechend dem Papier aus. Wenn du z.B. ein Poster auf glänzendem Bilderdruckpapier drucken lässt, nutze das Profil für Typ1/2 (PSO Coated). Für einen Buchdruck auf Naturpapier wähle das Uncoated-Profil (Typ4 oder 5, z.B. PSO Uncoated). So stellst du sicher, dass die Farben in der Datei auf die Eigenschaften des Papiers abgestimmt sind. Und die Druckerei wiederum wird ihre Maschinen so einstellen, dass sie die Lab-Zielwerte für dieses Papier trifft.
Vergleich mit früheren Versionen der Norm – was hat sich geändert?
Falls du bereits mit älteren Versionen (ISO 12647-2:2004/Amd2007) gearbeitet hast, fragst du dich sicher, was konkret anders ist in der aktuellen Fassung. Hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen gegenüber früheren Versionen und der neuen Anforderungen:
Neue Referenz-Profile (FOGRA51/52 statt FOGRA39/47)
Die wohl spürbarste Änderung für Praktiker war die Einführung neuer ICC-Profile. Für gestrichenes Papier löste PSO Coated v3 (FOGRA51) das alte ISOcoated_v2 (Fogra39) Profil ab; für ungestrichenes weißes Papier kam PSO Uncoated v3 (FOGRA52) ergänzend zum bisherigen PSO Uncoated (Fogra47) hinzu . Diese neuen Profile basieren auf geänderten Sollwerten und Messmethoden (M1) – sie passen also besser zur heutigen Realität (Papierweiße, Farbpigmente) und liefern in der Regel ein engeres Matching zwischen Proof und Druck . Die alten Profile wurden nicht über Nacht ungültig, aber gelten als „legacy“. In vielen Betrieben liefen alte und neue Standards eine Zeit lang parallel, doch mittelfristig wird das neue Set bevorzugt. (Es gibt übrigens DeviceLink-Profile, um Farben von alten auf neue Profile umzuwandeln und umgekehrt, um den Übergang zu erleichtern .)
Messbeleuchtung M1 statt M0
Früher wurde alles unter der Messbedingung M0 (undefinierte Lichtquelle, meist Glühlampenlicht) gemessen. Das führte bei optisch aufgehellten Medien zu Abweichungen zwischen visueller Wahrnehmung und Messung. Die neue Norm setzt daher M1 als bevorzugte Messart ein . Für dich praktisch heißt das: Du benötigst Spektralfotometer, die M1 unterstützen (z.B. X-Rite i1Pro2 oder neuere) . In der Qualitätskontrolle von Proofs ist M1 inzwischen ein Muss . Die Messung mit UV-Anteil sorgt dafür, dass die Papieraufheller berücksichtigt werden – der gemessene Blauanteil des Papiers entspricht dem, was man unter Normlicht sieht. In älteren Versionen war das nicht der Fall. Beachte: Inline-Messgeräte an Druckmaschinen arbeiten teilweise noch mit M0/M2, was laut Norm für die Prozesssteuerung tolerierbar ist, solange der finale Abgleich mit M1 erfolgt .
Angepasste Farborte der Skalenfarben
Die Lab-Zielwerte für Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz (und damit verbunden das Gesamtfarbprofil) wurden leicht verschoben. Beispielsweise ist das neue Cyan minimal „grüner/blauer“, das Gelb etwas kräftiger – alles, um den tatsächlichen Druckbedingungen besser zu entsprechen . Diese Änderungen sind subtil, aber messbar. Sie bedeuten auch: Ein Druck nach neuer Norm kann im direkten Vergleich zum alten Standard ganz leicht anders wirken (z.B. etwas brillanteres Gelb auf aufgehelltem Papier). Das ist gewollt, um die höhere Papierweiße und andere Materialeigenschaften auszugleichen.
Einheitliche Tonwertzunahme für alle Farben
Früher hatte Schwarz oft eine abweichende Tonwertzunahme-Kurve gegenüber CMY (z.B. Kurve A für CMY und B für K). In ISO 12647-2:2013 sind CMYK gleichbehandelt – es gibt also eine gemeinsame Kurvenfamilie für alle Prozessfarben . Das erleichtert die Kalibrierung: man muss nicht mehr unterschiedliche Plattenkurven für K vs. CMY einsetzen, sondern kann einheitlich justieren (natürlich je nach Papiertyp unterschiedlich). Zudem wurde für FM-Raster (stochastisches Rauschen) eine eigene Referenz definiert, was in früheren Versionen fehlte.
DeltaE2000 als neues Bewertungsmaß
Die Norm selber nennt DeltaE76 noch, aber informativ wird ΔE2000 empfohlen . Viele Prüfinstitute und Software haben daher umgestellt. ΔE2000 bewertet Farbabweichungen anders (gewichtet z.B. Helligkeit, Chroma und Hauttöne stärker). Praktisch merkst du das bei der Proof-Verifizierung: Ein Medienkeil kann nach ΔE00 ausgewertet strengere oder andere Ergebnisse liefern als nach ΔE76. Die Umstellung auf ΔE00 ist ein Schritt zu präziserer Qualitätsaussage, war aber in der alten Norm nicht vorgesehen.
Wegfall von Filmbasiertem und anderes
Wie schon erwähnt, alles was mit traditionellen Filmbelichtung und analogen Proofs zu tun hatte, ist rausgeflogen. Das betrifft dich heute kaum noch, außer dass ältere Bezeichnungen wie „Amendment“ oder Fogra-Proof auf Medienkeil V2 etc. Geschichte sind. Jetzt ist der Workflow vollständig digital (CTP, Digitalproof). Auch einige veraltete Anhänge wurden bereinigt . Neu hinzugekommen sind dafür Hinweise zur Verwendung von Papieren mit oder ohne optische Aufheller (OBA) und der Plan, zukünftig weitere Charakterisierungsdaten bereitzustellen, z.B. für OBA-freie Naturpapiere oder gelbliche Papiere . Das heißt, die Norm ist nicht in Stein gemeißelt – sie kann erweitert werden, wenn es die Praxis erfordert.
Kurzum: ISO 12647-2 hat sich mit der Zeit weiterentwickelt, um mit technologischen Änderungen Schritt zu halten. Die neueste Version stellt sicher, dass moderne Materialien (Papier, Farbe) und Methoden (Spektralmessung) berücksichtigt werden. Wenn du von einer älteren Version umsteigst, plane etwas Zeit ein, um Profile auszutauschen, Geräte zu prüfen und dich mit den neuen Vorgaben vertraut zu machen. Doch der Aufwand lohnt sich, denn die neuen Standards bieten eine noch verlässlichere Farbwiedergabe und vereinfachen dank Einheitlichkeit viele Abläufe.
Tipps für die Umsetzung der ISO 12647-2 im Unternehmen
Zum Abschluss möchten wir einige praktische Ratschläge geben, wie du ISO 12647-2 erfolgreich in deiner Organisation umsetzen kannst. Diese Tipps helfen Agenturen und Druckereien dabei, den Standard effizient und reibungslos in den Alltag zu integrieren:
Tipp 1: Aktuelle ICC-Profile nutzen
Stelle sicher, dass du die neuesten Farbprofile einsetzt. Lade dir von der ECI-Website die Profile PSOcoated_v3 (FOGRA51) für gestrichenes Papier und PSOuncoated_v3_FOGRA52 für ungestrichenes Papier herunter. Verwende diese in deinem Layout- und RIP-Workflow. Veraltete Profile wie ISOcoated_v2 solltest du nur noch benutzen, wenn ein Projekt ausdrücklich danach verlangt. Kommuniziere mit deinen Kunden oder Partnern, auf welchem Standard ihr arbeitet, damit alle denselben Profilstand verwenden.
Tipp 2: Farbmanagement-Workflow prüfen
Überprüfe den gesamten Color-Management-Workflow in deiner Produktion. Sind die Profile überall eingebettet? Wird das Ausgabeprofil im PDF/X korrekt angegeben? Ist dein Softproof-Monitor auf D50 kalibriert? Ein konsistenter Workflow vom Design bis zum Druck verhindert Brüche. Achte darauf, dass in den Adobe-Programmen die richtigen Arbeitsfarbräume eingestellt sind und dass keine unnötigen Farbkonvertierungen stattfinden. Im Zweifel: Erstelle Testdrucke mit eingebetteten Profilen und messe sie, um zu sehen, ob die Ergebnisse im Soll liegen.
Tipp 3: Proofing an die Norm anpassen
Ein Proof ist nur so gut wie seine Übereinstimmung mit dem Druck. Verwende deshalb Proof-Materialien und Einstellungen, die ISO 12647-2 gerecht werden. Konkret: Nutze Proof-Papiere, die den Weißton des Auflagenpapiers simulieren (für FOGRA51/52 also Papiere mit optischen Aufhellern, weil die Auflagenpapiere OBAs haben) . Kalibriere dein Proof-System neu auf die neuen Profile. Außerdem sollte der Proof mit einem Medienkeil ausgemessen werden. Dabei nach Möglichkeit ΔE2000 als Bewertungsgrundlage nehmen, um ein realistisches Ergebnis zu erhalten. So kannst du dem Kunden einen zertifizierten Proof nach aktuellem Standard vorlegen.
Tipp 4: Messtechnik upgraden
Überprüfe deine Messgeräte. Ältere Spektralfotometer messen oft nur nach M0. Um die Norm voll auszuschöpfen, brauchst du ein Gerät mit M1-Modus . Geräte wie X-Rite i1 Pro2, Konica-Minolta FD-5/7 oder Techkon SpectroDens (neuere Versionen) unterstützen M1. Mit solchen Geräten erhältst du Messwerte, die mit den Referenz-Lab-Werten vergleichbar sind. Falls ein Austausch des Geräts gerade nicht möglich ist, kannst du workaround: Messe den Papierweißpunkt separat und berücksichtige den Unterschied – aber ideal ist das nicht. Die Investition in moderne Messtechnik zahlt sich aus, da du dadurch Proof und Druck präzise abstimmen kannst. Normlicht im Auswertungsraum ist ebenfalls Pflicht: Beleuchtungsanlagen nach ISO 3664 (D50) sorgen dafür, dass du visuell das Gleiche siehst, was die Messegeräte messen .
Tipp 5: Schulung und Teamwork
Nimm alle Beteiligten mit ins Boot. Führe Schulungen für Mitarbeiter durch, um das Bewusstsein für den Standard zu schärfen. Erkläre den Kollegen in Vorstufe, Drucksaal und QM, warum ihr bestimmte Werte anstrebt und was zu tun ist, wenn Abweichungen auftreten. Ein gut informierter Mitarbeiter kann Probleme (z.B. falsches Profil im PDF, oder Farbstich im Proof) frühzeitig erkennen und beheben. Etabliert Checklisten: Ist das richtige Profil eingebettet? Stimmt der Papiertyp? Wurden Sonderfarben richtig konvertiert? – Solche Punkte sollten Routine werden. Außerdem lohnt sich der Erfahrungsaustausch mit anderen Druckereien oder Fachgruppen (z.B. im Rahmen des Print Standardizer Networks), um von Best Practices zu profitieren.
Tipp 6: Schrittweise Umstellung mit Tests
Falls dein Betrieb noch nach der alten Norm arbeitet und umsteigen will, plane eine schrittweise Einführung. Fahre Testdrucke nach dem neuen Standard, vergleiche sie mit alten Druckmustern, um die Auswirkungen einzuschätzen. Eventuell entwirfst du ein Profiling-Testchart und lässt es nach neuer Norm drucken, um eigene ICC-Profile zu prüfen oder deine Maschinen neu zu linearisieren. Nutze die von Fogra/BVDM angebotenen Audit-Druckformen oder Testformen, um deine Maschine gegen den neuen Standard einzustellen. So kannst du in kontrolliertem Rahmen die Einstellungen optimieren, bevor du es auf Kundenjobs anwendest.
Tipp 7: Kommunikation mit Kunden
Informiere deine Kunden, dass du nach ISO 12647-2 arbeitest. Das schafft Vertrauen und verdeutlicht Professionalität. Erkläre ggf., was es bedeutet (z.B. „Wir drucken nach ProzessStandard Offsetdruck, das garantiert Ihnen eine konsistente Farbwiedergabe nach dem internationalen Standard ISO 12647-2.“). Sollte ein Kunde eigene Farbvorstellungen haben, kannst du dies mit Verweis auf die Norm diskutieren („Ihr Corporate-Blau liegt außerhalb des Standard-Farbraums, wir können max. diesen Lab-Wert erzielen …“). Solche Gespräche verlaufen auf Basis von Fakten statt Bauchgefühl, wenn du die Norm als Rückhalt hast.
Tipp 8: Bleib auf dem Laufenden
Die Druckbranche entwickelt sich weiter. Halte dich über Updates der ISO-Normen oder Fogra/ECI-Mitteilungen auf dem Laufenden. Es ist möglich, dass in Zukunft weitere Druckbedingungen (Profile) hinzugefügt werden – z.B. für neue Papiersorten oder Druckverfahren. Durch Newsletter von Fachverbänden oder den Besuch von Branchen-Events (wie Druckfachkonferenzen) stellst du sicher, dass dein Wissen aktuell bleibt. So kannst du frühzeitig auf Änderungen reagieren und bleibst wettbewerbsfähig.
Mit diesen Tipps bist du gut gerüstet, ISO 12647-2 in der täglichen Praxis zu meistern. Denke daran: Standardisierung ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Aber je mehr es zur Routine wird, desto mehr zahlt es sich in Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit aus.
FAQ
Was ist die ISO 12647-2 Norm in einfachen Worten?
ISO 12647-2 ist eine internationale Drucknorm, die sicherstellt, dass im Offsetdruck alle Beteiligten (Vorstufe, Druckerei, etc.) nach denselben Qualitätszielen arbeiten. Sie definiert u.a. welche Farbwerte und Toleranzen beim Drucken erreicht werden sollen. Kurz gesagt: Es ist ein Standard, der beschreibt, wie man farbverbindlich druckt – vom richtigen Papierweiß bis zur exakten Cyan-Druckfarbe.
Warum ist ISO 12647-2 wichtig für Farbmanagement?
Ohne einen Standard würde jeder Druckerei-Betrieb nach eigenem Gutdünken arbeiten – Farben könnten stark variieren. ISO 12647-2 gibt Referenzwerte vor, die im Farbmanagement als Ziel dienen. ICC-Profile wie „ISO Coated“ basieren genau auf diesen Vorgaben . Dadurch wird ein Standard-Druck ermöglicht: Designer, Proof und Druckmaschine sprechen eine Sprache. Für das Farbmanagement bedeutet das verlässliche Simulation und Kontrolle der Farben entlang der Produktion.
Welche Papiertypen deckt ISO 12647-2 ab?
Die Norm definiert fünf Haupt-Papiertypen (1 bis 5) im Akzidenz-Offsetdruck : Zwei gestrichene (coated) Papiere (glänzend und matt), ein LWC-Rollenoffsetpapier und zwei ungestrichene (ein weißes, ein gelbliches). Für jeden Typ gibt es eigene Zielwerte, z.B. anderes Papierweiß und angepasste Tonwertzunahme. (Zeitungsdruck auf Zeitungspapier fällt nicht unter ISO 12647-2, sondern unter ISO 12647-3.)
Was sind FOGRA51 und FOGRA52?
FOGRA51 und FOGRA52 sind neue Charakterisierungsdatensätze bzw. Druckbedingungen, die mit ISO 12647-2:2013 eingeführt wurden . FOGRA51 (Profilname „PSO Coated v3“) gilt für Bilderdruckpapier (Typ1 glänzend/Typ2 matt) und hat ISOcoated_v2 abgelöst. FOGRA52 (Profil „PSO Uncoated v3“) gilt für ungestrichenes Offsetpapier (Typ5 weiß holzfrei) und ergänzt den früheren Standard für Naturpapier. Diese Datensätze enthalten die Lab-Zielwerte für Farben und werden als ICC-Profile genutzt, um entsprechend zu drucken.
Ich hoffe, dieser Überblick hat dir geholfen, die aktuelle ISO-12647-2 Norm und ihre Bedeutung für Farbmanagement, Druckstandardisierung und Praxisanwendung besser zu verstehen. Mit diesem Wissen bist du bestens gerüstet, um im Arbeitsalltag fundierte Entscheidungen rund ums Farbmanagement, Farbprofile, Papiertypen und Farbwerte zu treffen – ganz im Sinne eines erfolgreichen Standard-Druck-Workflows! Viel Erfolg beim Umsetzen und stets gute Farben!